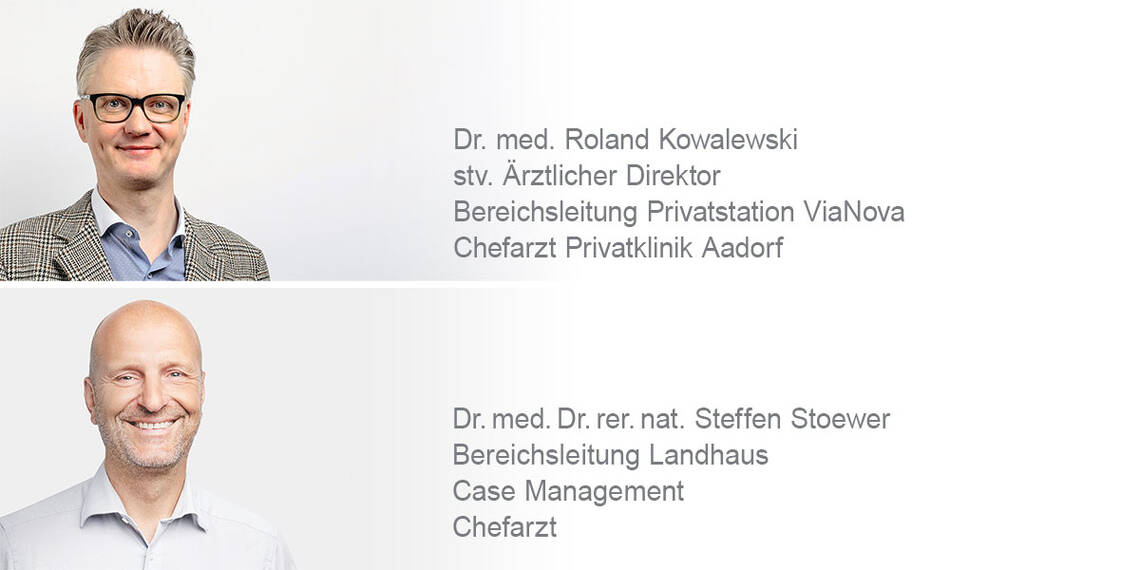PSychische Komorbiditäten
Depression und Angst kommen selten allein
Patientinnen und Patienten, die primär mit der Diagnose einer Depression oder Angststörung zur Behandlung kommen, zeigen häufig auch Symptome anderer psychischer Störungen oder erfüllen gar deren diagnostische Kriterien. Wie hängen diese Komorbiditäten zusammen? Wir ordnen ein.
Beim Vorliegen einer Depression oder einer Angststörung sind oftmals psychische Komorbiditäten zu beobachten. Typische Beispiele sind Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Suchterkrankungen.
Die Zusammenhänge zwischen Depressionen und Angststörungen einerseits und ADHS, Traumafolgestörungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Suchterkrankungen andererseits sind komplex und individuell sehr unterschiedlich. Depressionen und Angststörungen liegen nicht selten komorbid vor. Die Symptome können sich überschneiden und gegenseitig verstärken, was Diagnose und Behandlung erschwert. Auch die neurobiologischen Mechanismen, zum Beispiel Dysregulationen im Serotonin- oder Noradrenalin-System, ähneln sich.
Komorbiditäten im Zusammenhang mit ADHS Bei Patientinnen und Patienten mit ADHS sind komorbide Depressionen oder Angststörungen auch erklärlich als Folge von ADHS-typischen Problemen im Alltag. Zu diesen zählen unter anderem Konzentrationsschwierigkeiten, impulsives Verhalten und emotionale Dysregulation.
ADHS tritt zudem gehäuft mit Persönlichkeitsakzentuierungen und -störungen auf, insbesondere der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Kein Wunder, denn beide Störungen zeigen Probleme mit der Impulskontrolle und der emotionalen Stabilität. Und diese Symptome erhöhen ihrerseits die Wahrscheinlichkeit, eine interaktionelle Problematik oder eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln oder eine Traumatisierung zu erleiden. Insbesondere dann, wenn eine ADHS nicht behandelt wird, resultieren Schwierigkeiten in Schule, Beruf und sozialen Beziehungen. Diese tragen zu einem negativen Selbstbild bei, was wiederum zu Depressionen wie auch zu Angststörungen beitragen kann. Ausserdem – sozusagen dem vorausgehend – zeigen sich bei diesen Störungen gemeinsame genetische Faktoren oder frühe traumatische Erfahrungen. Jedenfalls belegen grosse Metaanalysen eindeutig das gehäufte Auftreten von Persönlichkeitsstörungen bei Patientinnen und Patienten mit ADHS, Depression, Angst- oder Zwangsstörungen.
Komorbiditäten im Zusammenhang mit Suchterkrankungen
Auch Suchterkrankungen sind bei Depressionen, Angst- wie auch Persönlichkeitsstörungen gehäuft. Diese können depressive oder ängstliche Symptome verstärken, umgekehrt verwenden Menschen mit Depressionen oder Angststörungen nicht selten Substanzen zur Selbstmedikation. Alkohol entlastet und beruhigt zwar erst einmal, die Alkoholabhängigkeit geht aber in bis zu 80 Prozent der Fälle mit der Entwicklung einer Depression einher, offenbar auch auf «direkt neurobiologischem» Weg. Der Kokainentzug ist berüchtigt für den «Kokain-Crash», eine kurzfristige, mitunter gefährliche depressive Krise.
Emotionale Instabilität und Impulsivität, wie bei der Borderline- Persönlichkeitsstörung oder bei ADHS, erhöhen direkt das Risiko für kompulsiven Substanzgebrauch. Gleichzeitig kann auch hier der Konsum als Selbstmedikation erfolgen, zum Beispiel, um emotionale Schmerzen und innere Leere oder Konzentrationsprobleme und innere Unruhe zu lindern. Dementsprechend ist die Lebenszeitprävalenz für Suchterkrankungen auch bei Menschen mit ADHS deutlich erhöht.
Neurobiologische Hintergründe
Gemeinsame neurobiologische Mechanismen umfassen eine Vielzahl von Transmittersystemen. Gut erforscht sind dabei Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, GABA und Glutamat. Störungen im Dopaminsystem betreffen besonders Motivation, Belohnung und Impulskontrolle. Serotonin ist wesentlich für die Regulation von Stimmung, Angst und Impulsivität. Somit ist der Zusammenhang mit Depressionen und Angststörungen besonders markant. Noradrenalin erhöht unter anderem die Aufmerksamkeit und emotionale Erregung. Zu wenig trägt zu Energiemangel bei, zu viel hingegen zu Anspannung und Angst. Auch Glutamat und GABA spielen eine wesentliche Rolle beim Einregulieren von Erregung und Hemmung.
Diese und weitere Teile der neurobiologischen Ausstattung sind zunächst polygenetisch determiniert. Das heisst, dass mehrere Gene den Phänotyp mitbestimmen und sich so gegebenenfalls zu erhöhter Anfälligkeit für psychische Störungen aufsummieren. Umweltfaktoren können die Expression und die Ausprägung von Genen «epigenetisch» nachhaltig beeinflussen: Unter anderem können traumatische Erfahrungen oder chronischer, insbesondere sozialer Stress die Genexpression modulieren und «neuroinflammatorisch» die Hirnentwicklung, einschliesslich des Stresssystems, beeinträchtigen. So lassen sich beispielsweise Veränderungen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden- Achse (HPA-Achse) bei etlichen psychischen Störungen nachweisen.
Etwas abstrakter zusammengefasst heisst das: Das Integral biologischer, sozialer wie auch psychologischer Prägungen interagiert über komplexe Rückkoppelungen (Hormone, Epigenetik, Transmitter etc.) mit dem richtigen Leben, wo sich Probleme zu krankheitswertigen Reaktionsweisen und Zuständen aufschaukeln können. Die resultierende Kompensatorik kann dann zusätzlichen Kummer oder gar Krankheitsbilder bedingen.
Fazit
Die Belastung durch eine psychische Störung wird die Entwicklung weiterer Problembereiche und auch Diagnosen begünstigen. Die Zusammenhänge sind multifaktoriell und individuell ganz unterschiedlich.
Komorbiditäten entstehen zudem über gemeinsame genetisch- neurobiologische Faktoren sowie Umwelt- und Entwicklungsfaktoren, aber auch Symptombereiche, die sich gegenseitig verstärken oder auch einfach phänomenologisch überlappen.
Über eine sorgfältige Diagnostik und Kenntnis typischer Wechselwirkungen wird der Zugang zu einer evidenzbasierten Behandlung gewährleistet und ein weiteres «Aufschaukeln» der typischen Symptom- und Diagnosebereiche (Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, ADHS, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen) vermieden.
LAden Sie sich das Vollständige Apropos Nr. 27 - Inklusive dieses Artikels - als PDF herunter.
Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe? WIR SIND FÜR SIE DA!
RUFEN SIE UNS AN
+41 52 368 88 88
SCHREIBEN SIE UNS
info(at)klinik-aadorf.ch